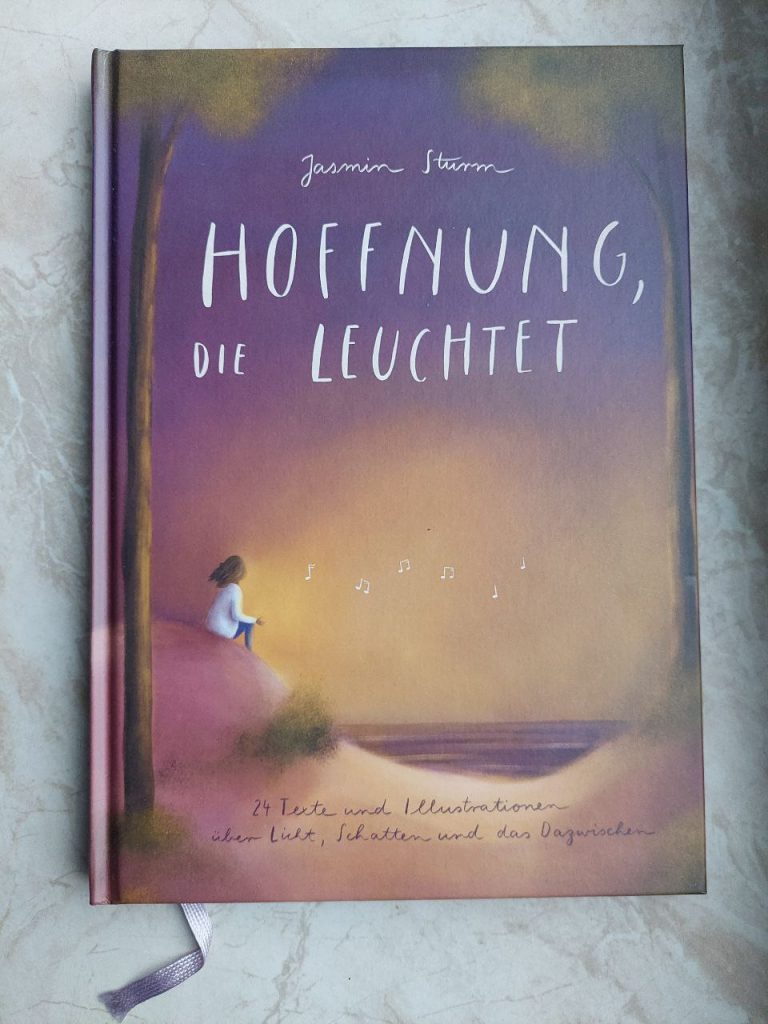Manchmal lese ich Bücher, die ich schrecklich finde, die problematische Inhalte vermitteln – und trotzdem kommt es nicht selten vor, dass ich diese Bücher fertiglese. Manchmal hat mich doch irgendwas gehooked in der Geschichte, meistens blicke ich einfach nur besonders tief in diesen Abgrund, wie bei einem Unfall, bei dem man weggucken möchte, aber nicht kann. Diese Bücher geben mir einen Eindruck davon, wie viel noch zu tun ist.
Es kommt, zugegebenermaßen, nicht allzu oft vor, dass ich an solche Bücher gerate, auch wenn garantiert die Mehrzahl der Neuerscheinungen nicht so sensibel ist, wie ich sie mir wünschen würde. Die meisten Bücher, die ich mittlerweile lese, sind ziemlich gut. Ich vertraue den Empfehlungen von Freund*innen und Buchblogger*innen, denen ich auf Social Media folge, entdecke unter den Ankündigungen der Verlage Neues und Interessantes und manchmal auch tatsächlich einfach spontan im Laden oder in der Bibliothek.
Hin und wieder aber mache ich dort einen Fehlgriff oder mir wird ein Buch geschenkt, hinter dessen Sprache und oder Geschichte ich nicht stehen kann. Es sind häufig Bücher, die besonders divers und inklusiv sein wollen, dabei aber grundlegende Regeln beim Schreiben vergessen wurden. Ich stoße auf Bücher mit Repräsentation von behinderten Menschen, wo allem Anschein nach weder Autor*in noch Lektorat sich die Mühe gemacht haben, basic Regeln rund um nichtableistische Sprache zu recherchieren, sondern fröhlich weiter reproduzieren, was seit Jahren kritisiert wird. Oder Bücher mit queeren Personen, die ein Klischee nach dem anderen erfüllen, trans Personen, die komplett unnötig gedeadnamed und misgendert werden usw usw. Ein gravierendes und leider auf dem Buchmarkt ziemlich erfolgreiches Beispiel dafür ist „Mein Bruder heißt Jessica“ von John Boyle über ein trans Mädchen – in dem also schon im Titel gemisgendert wird. Der gesamte Fokus ist auf dem Geschwisterkind aus dessen Perspektive geschrieben wird, all seinen Struggles, ohne dass die Probleme des trans Mädchens wirklich ernstgenommen werden, geschweige denn irgendwie sensibel aufgearbeitet.
Es gibt nach wie vor einfach viel zu viele Bücher, die vor diskriminierender Sprache und Inhalten nur so triefen. Und, klar, wir Autor*innen können nicht alles wissen. Aber: Wir sollten uns weiterbilden, so wie es alle Menschen im Rahmen ihrer Möglichkeiten tun sollten, um andere nicht zu diskriminieren und zu verletzen. Gerade wir, die wir mit unseren Worten eben auch Gesellschaft abbilden und gleichzeitig unsere Lesenden mit unserer Sprache und unseren Inhalten prägen, sollten besonders achtsam sein. Und da wir eben nicht alles wissen müssen und können, sollten wir uns Hilfe holen. Genau deshalb gibt es doch Angebote wie Sensitivity Reading und/oder Sensitivity Beratung.
Liebe Autor*innen, nehmt diese Hilfe an. Setzt sie bei euren Verlagen durch. Liebe Verlage, nehmt diese Hilfe an. Bezahlt sie angemessen. Und dann freut euch über bessere Bücher. Es ist am Ende ein Win-Win für alle.